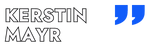Wer mich besser kennt weiß: Ich bin durchaus ein Gewohnheitsmensch. Ja – ich lese und lerne liebend gerne Neues (sonst hätte ich wenig in diesem Newsletter zu berichten) – aber mein Leben ist durchzogen von Routinen. Und nein – damit meine ich nicht notwendigerweise die seit geraumer Zeit propagierten Selfcare-Routinen mit Mittagspausen-Yoga und Anti-Stress-Tee zur Morgenmeditation.
Ein Beispiel: Seit meiner Teenagerzeit habe ich eine Vorliebe für eine bestimmte Art von Turnschuh – oder Neudeutsch Sneaker. Ist mein aktuelles Paar kaputtgelaufen, kaufe ich das exakt gleiche Modell wieder nach. Gleiches gilt für meine Armbanduhr. Natürlich besitze ich auch andere Schuhe – aber der Umstand, dass ein geliebtes Paar Schuhe kaputt ist, wird leichter erträglich, wenn ich weiß, dass ja ohne größere Umstände wieder ein neues, exakt gleiches parat steht. Keine Sorge; das soll kein Lobgesang auf Lieferketten oder den Wegwerfkapitalismus werden. Nein – es ist eine Ode an die Routine: die Freiheit, sich nicht für ein neues paar Schuhe entscheiden zu müssen.
“Wer keine üblen Gewohnheiten hat, hat wahrscheinlich auch keine Persönlichkeit.”
William Faulkner
Das Sich-immerzu-neu-entscheiden-müssen ist anstrengend – es kostet wertvolle Ressourcen, die man auch anderweitig nutzen könnte. Warum soll ich Zeit damit verschwenden, mir zu überlegen, was ich sonst noch alles für tolle Schuhe haben könnte, wenn ich genau weiß, welches Paar gut sitzt und zu 80 % meines Kleiderschrankinhaltes passt? Na also. Trotzdem ernte ich regelmäßig Spott von Freund:innen und Kolleg:innen. Dass ich aber jedes Mal denselben Arbeitsweg wähle – das findet komischerweise niemand schräg.
Routinen haben einen schlechten Ruf – zu unrecht
Denn sie nehmen uns nicht nur Entscheidungen ab – sie machen uns dadurch erst (über)lebensfähig. Man stelle sich vor, dass wir jede noch so kleine und banale Entscheidung immer neu fällen müssten. Wir würden ja morgens wahrscheinlich gar nicht mehr aus dem Haus kommen: Blaues T-Shirt oder gelbes? Toast zum Frühstück oder Müsli? Jede Option hat Argumente dafür und dagegen – und wir können sie rational nicht entscheiden. Es ist recht rational, bei Regen einen Schirm mitzunehmen. Es ist nicht rational, ein blaues Shirt einem grünen vorzuziehen. Beim Entscheiden solcher Fragen helfen uns Emotionen, das ominöse Bauchgefühl und eben auch Routinen.

Noch nicht überzeugt? Dann darf ich Elliot vorstellen. Elliot ist das Alias eines Patienten des Neurologen Antonio Damasio. Elliot, ein erfolgreicher Jurist, war ein Vorbild für seine Kolleg:innen, ein liebevoller Ehemann und Vater. Bis ein Tumor von der Größe einer Zitrone sein vorderes Stirnhirn zerstörte. Das Geschwür wurde entfernt, auf den ersten Blick änderte sich nichts. Sein IQ war gleich geblieben, aber sein Bauchgefühl war weg: Während der Arbeit konnte er stundenlang grübeln, wie er die Papiere auf seinem Schreibtisch ordnen sollte. Ständig verzettelte er sich. Elliot wurde gekündigt, schließlich ging auch seine Ehe in die Brüche. Der Neurologe Damasio machte mit ihm verschiedene Tests, unter anderem spielte er mit ihm ein Kartenspiel, bei dem es gute und schlechte Karten gab. Doch obwohl Elliot das System hinter dem Spiel verstand, wählte er weiterhin die riskanten Karten und verlor Runde um Runde. Es war ihm unmöglich, aus vergangenen Entscheidungen zu lernen und Heuristiken für zukünftiges Handeln zu entwickeln. Sein Lebensende verbrachte er verarmt in der Obhut seiner Familie.
Routinen geben Sicherheit – und das ist nicht immer schlecht
Routinen ordnen nicht nur unseren Alltag in dem sie uns Entscheidungen erleichtern – sie geben auch Sicherheit. Es ist kein Zufall, dass insbesondere in den letzten Jahren die Nachfrage nach Selfcare-Routinen und Mindfulness stark zugenommen hat. In einer Welt, die – gefühlt – immer unsicherer wird (Pandemie, hohe Inflation, Niedrigzinsen, Klimawandel, etc.), sehnen wir uns nach Sicherheit. Wenn wir schon nicht wissen, wie die Welt von morgen aussieht, ist es doch beruhigend zu wissen, dass wenigstens unsere Yoga-Matte noch da sein wird.
Und auch in der neuen agilen Arbeitswelt sind Routinen nicht verkehrt, obwohl hier oft das gegenteilige Dogma propagiert wird: Wird unser Umfeld unsicherer, müssen wir flexibler werden, um schneller zu reagieren! Was im ersten Moment schlüssig klingt, birgt aber auch Probleme: Arbeiten auf Zuruf birgt Fehlerpotenzial und erhöht den Abstimmungsaufwand. Das ständige Neuordnen von Prioritäten und das fortwährende Anpassen von Prozessen verlangt einen nicht zu unterschätzenden Ressourcenaufwand. Und das geht zulasten des Produktionsoutputs: Wer neuordnet oder den ganzen Tag in Abstimmungs-Meetings sitzt, kann nicht wertschöpfend unterwegs sein. Kluge Routinen (=Prozesse) können hier helfen (Eigenwerbung).

Die routinierte Veränderung
“Nichts ist so beständig wie der Wandel” – wusste schon Heraklit von Ephesus, lange, bevor Management-Gurus wie Peter F. Drucker und Thomas Peters die Innovationsfähigkeit von Unternehmen als Grundlage für den Erfolg ebenjener anpriesen. “Wer schläft verliert”, hatte sich vielleicht auch der innovationsunwillige Henry Ford gedacht, als er nur drei Jahre nach dem Zenit seiner Marktführerschaft die Produktion des berühmten Model Ts einstellen musste. Optimal effiziente Routinen sind eben doch nicht alles.
Aber wie geht man mit Veränderungen am besten um?
Manager:innen, Berater:innen und selbsternannte Change-Expert:innen haben sich in den vergangenen Jahren unzählige Gedanken gemacht und diese in Handlungsempfehlungen gegossen, die man z.B. hier, hier, hier oder hier erwerben und ausprobieren kann. Das Interessante dabei: So unterschiedlich die Gründe für die Veränderungen und die Transformationen selbst auch sein mögen – die zu befolgenden Schritte bleiben immer gleich:
-
-
-
- Klare Ziele setzen
- Betroffene Personengruppen identifizieren
- Mitarbeitende als zentrale Ressource nutzen
- Transparente und frühzeitige Kommunikation
- Ermutigung zur Selbstorganisation
- Ausreichend Ressourcen bereithalten
- Wandel als permanenten Prozess begreifen
-
-
Es entsteht der Eindruck, jede noch so komplexe Transformation könne ganz einfach geplant und gesteuert werden – wenn man nur die oben genannten Schritte korrekt ausführe.
Was hier passiert? Das urmenschliche Bedürfnis nach der Planung und Steuerung des Unberechenbaren bricht sich seinen Bann: Der Wandel wird selbst zu einer Routine. Und hier kommen dann auch die Risiken ins Spiel, die Routinen leider mit sich bringen: zum Beispiel Betriebsblindheit. Wer davon überzeugt ist, den optimalen Prozess für eine Business-Transformation (oder einen Schuhkauf) gefunden zu haben, der wird selbst im Fall von Misserfolgen eher dazu neigen, diese auf das Nicht-einhalten bestimmter Regeln zu schieben als den Prozess (oder den Wandel) als solchen infrage zu stellen. Dann werden Routinen gefährlich.
Hierzu empfehle ich als Lektüre unter anderem diesen Artikel von Stefan Kühl.
Dieser Post ist im Original als Beitrag des kibibetters im November 2021 erschienen.
Related Posts
1. Juni 2023
Von Mainstream, Nischen und Neugier
Wann habt Ihr zuletzt eine Doku über Syphilis geschaut? Ich erst vergangene…
1. Juni 2023
Die Entzauberung des Management-Sprechs
Habt ihr heute schon im New Normal Synergien gebildet oder jemanden im Loop…
1. Juni 2023
Purpose vs. Pragmatismus
Der Jahreswechsel wird sowohl privat als auch beruflich oft als Neustart und…