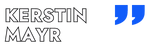In dieser Ausgabe des kibibetters möchte ich zwei Themen miteinander verknüpfen, die mir beide sehr am Herzen liegen: Sprache und (soziale) Gerechtigkeit. Der Weg dorthin führte mich über unterschiedliche Stationen, die ich direkt ohne viel Vorrede mit Euch gemeinsam rekapitulieren möchte. Also – bear with me:
Es begann mit einem anderen Newsletter, dem von L.M. Sacasas, auf den ich mich jede Woche diebisch freue. In dieser Ausgabe äußert und verteidigt er die These, dass wir nicht in einer Simulation (Metaverse, anyone?) sondern stattdessen viel eher in der Vergangenheit leben. Wie kommt er darauf? Sacasas bezieht sich insbesondere auf das Internet, welches in seinen Augen ein bloßes Abbild der Vergangenheit und eine Reorganisation von bereits Dagewesenem sei. Er führt sieben Argumente für seine These an, wobei mich Nummer vier zum Nachdenken brachte:
“On the internet, fighting about what has happened is far easier than imagining what could happen.”
[Frei übersetzt: Im Internet ist es viel einfacher über das zu streiten, was vergangen ist, als sich vorzustellen, was noch kommen könnte.]
Ich kam nicht umhin mich zu fragen: Wenn ich die Zukunft formen möchte, muss ich sie mir vorstellen – ich muss sie jedoch auch verbalisieren, oder nicht?
Kritische Stimmen würden jetzt sicher intervenieren: Reden wir nicht schon genug über die Zukunft – sollten wir nicht stattdessen lieber weniger reden und mehr handeln? Aber inwieweit prägt Sprache unser Handeln? Meiner Ansicht nach spielt Sprache für die Gestaltung von Zukunft eine elementare Rolle. Indem wir Ideen denken, formulieren und in Narrativen zusammenfügen, können wir beschreiben, was aktuell ist, feststellen, was vor uns liegt und entwickeln, was zukünftig getan werden muss.
Die Geschichten, die wir uns erzählen
Wir Menschen sind Geschichtenerzähler:innen. Und vereinfacht ausgedrückt ist ein Narrativ eine Geschichte über etwas. Geschichten sind für uns essenziell, weil wir als Menschen und soziale Wesen erzählende Kreaturen sind. Durch Geschichten geben wir der Welt um uns herum einen Sinn – wir ordnen, bewerten, rechtfertigen. In seinem Roman Der Ekel von 1938 schrieb Jean-Paul Sartre: „Ein Mann ist immer ein Geschichtenerzähler, er lebt umgeben von seinen Geschichten und den Geschichten anderer, er sieht alles, was ihm widerfährt, durch sie; und er versucht, sein Leben so zu leben, als würde er es erzählen.“ Robert Shiller, der Vater der narrativen Ökonomie, geht noch einen Schritt weiter und verbindet Narrative mit den Entscheidungen, die wir treffen: „Das menschliche Gehirn war schon immer stark auf Narrative eingestellt, ob Tatsachen oder nicht, um laufende Handlungen zu rechtfertigen.“
Narrative bilden folglich den Kontext, in dem wir unsere subjektiven Tatsachen interpretieren. Daraus leiten wir auch Handlungen ab. Es handelt sich also nicht um bloße, theoretische Geschichten, sondern um Ideen, die wir als Wahrheiten antizipieren – unsere subjektiven Realitäten quasi. Und diese bleiben nicht unter sich. Geschichten sind da, um weitergetragen zu werden. Auf der Basis von kollektiven Narrativen entstehen Gesellschaften und ganze Kulturen.
Die Macht der Narrative: Spalten, vereinen, blockieren
OK. Ich gebe zu, das ist alles etwas abstrakt. Daher hier ein praktisches Beispiel:
Im Jahr 2014 war ich für ein Auslandssemester in Schweden. Ich hatte zuvor noch nicht allzu viel Kontakt zu ausländischen Studierenden gehabt – oder generell zu Personen aus anderen Kulturkreisen. Und dennoch: Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Ich hatte sofort Themen, über die ich mich mit Arkadiy aus Jakutsk, Ali aus Kairo und Roberta aus Brasilien austauschen konnte. Wohlgemerkt: Wir waren alle in vollkommen unterschiedlichen Studienfächern eingeschrieben. Was wir aber gemeinsam hatten, war trotz der kulturellen Unterschiede eine ähnliche soziale Herkunft, die sich zwischen Wolfsburg, Kairo und Jakutsk gar nicht so sehr unterscheidet. Wir kannten dieselben Bücher und Filme, hatten teilweise ähnliche familiäre Hintergründe und uns einte eine kosmopolitische Vorstellung von der Welt, in der wir leben. Schließlich waren wir alle aus bestimmten Gründen von Zuhause weg ins Ausland gegangen. Und genau diese Narrative – aufbrechen in die weite Welt um den eigenen Horizont zu erweitern, berufliche Chancen zu verbessern oder einfach mal von Zuhause weg zu kommen – waren die einende Basis für eine wirklich schöne Zeit.
Ich bin mir sicher, jede:r von uns hat ähnliche Situationen erlebt: Man kommt in eine Gruppe und fühlt sich gut aufgehoben – oder eben nicht. Häufig spielt die Art und Weise, wie wir die Welt sehen (und gerne hätten), für unser Wohlbefinden eine zentrale Rolle. Erzählen wir uns Geschichten von einer Welt, in der die weiße, “überlegene” Minderheit von fremden, vermeintlich minderwertigen Kulturen ausgerottet werden soll – oder sprechen wir davon, wie der Austausch zwischen Kulturen den eigenen Horizont erweitert? Teilen wir Familiengeschichten über Flucht und Vertreibung, können dies verbindende Narrative sein. Glaube ich an den Aufstieg durch harte Arbeit, gehe ich mit einer anderen Motivation an meinen Job als jemand, der an die Ausbeutung der Arbeiterklasse glaubt.
Die Autoren Friedemann Karig und Samira El Ouassi haben darüber ein Buch geschrieben, wie aus Narrativen kollektive Zukünfte entstehen und nennen darin ähnliche Beispiele. Das Narrativ Vom Tellerwäscher zum Millionär ist ein sehr bekanntes. Es ist eine eigentlich sehr ermutigende Geschichte, die besagt, dass man es durch harte Arbeit zu finanziellem Wohlstand bringen kann. Außerdem ist sie ein fester Anker des US-amerikanischen Selbstbildes. Diese Idee ist so tief in der amerikanischen Gesellschaft verwurzelt, dass kaum eine Debatte über Armut geführt werden kann, ohne dass den Armen Faulheit und Schmarotzertum vorgeworfen wird. Man klebt so sehr an einer Geschichte, die man gerne glauben möchte, dass systemische Realitäten schlichtweg ignoriert werden. Und so tatsächliche Debatten, Fortschritt und eine (vielleicht) bessere Zukunft verhindern.
Wir sehen deutlich: Aus Geschichten entstehen knallharte Realitäten bis hin zu Kulturen, wenn sie nur von ausreichend vielen Menschen reproduziert werden. Ein weiteres, sehr bekanntes Beispiel: Religionen.
Und wo Religionen sind, ist Krieg oft nicht weit.
Weniger religionsgetrieben, dafür stark von kollektiven (verzerrten) Narrativen durchsetzt, ist der aktuelle Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Durch die (absichtsvolle Miss-)Interpretation der Geschichte werden Feinde und Freunde definiert und Kriegsgründe im wahrsten Wortsinne herbeigeredet.
Seit Menschheitsbeginn werden Narrative genutzt, um grausame Verbrechen zu rechtfertigen und Armeen auf die Schlachtfelder dieser Welt zu hetzen. Die Autorin Ivana Milojevic hat in ihrem Artikel über Visionen des Friedens ebenjene kriegstreibenden Narrative entlarvt. Sie beschreibt diese als zukunftsgerichtete Fehlannahmen (Beispiel: die Wiedergutmachung von Ungerechtigkeiten à la Versailler Vertrag). Und sie schließt daraus – meines Erachtens ganz folgerichtig – dass zur Friedenssicherung auch kollektive Narrative gehören, die sich über Sprache ins kollektive Handeln übertragen.
Dieser Post ist im Original als Beitrag des kibibetters im November 2021 erschienen.
Unsere Sprache prägt unser Bewusstsein – und dadurch unser Handeln
Ein sehr einfaches, aber auch sehr anschauliches Beispiel ist die jüngste Debatte über Kriegsmetaphern in der deutschen Sprache. Letztere ist nämlich voll davon. Wenn man nur mal eben seinen Freunden erzählen möchte, wie der eigene Tag war, hat man plötzlich im Büro an allen Fronten gekämpft, offene Flanken geschlossen, und mit der Gartenarbeit auf Kriegsfuß gestanden. Ups.
Aber ist das wirklich so schlimm? Naja, wenn man davon ausgeht, dass Sprache Bewusstsein und dadurch Realitäten schafft, sollte man zumindest mal die Aggressivität seiner eigenen Wortwahl reflektieren.
Dazu George Orwell: “Wenn das Denken die Sprache korrumpiert, korrumpiert die Sprache auch das Denken” und der Coach Sebastian Mauritz in der Süddeutschen Zeitung: “Wenn wir ständig Kriegsmetaphern benutzen, gewöhnen wir uns an die Denkweise. Das Leben wird damit zu einem dauerhaften inneren Kampf. Und ständiges Kämpfen strengt den Geist und den Körper an. Wir reagieren mit Stress, um die Bedrohung zu beseitigen oder ihr zu entgehen. Dabei verstärken wir diese durch unsere Sprachwahl um ein Vielfaches. Wer im Beruf von Angriff, Verteidigung, Frontlinien und Durchstößen redet, sitzt halt irgendwann auch mit emotionalem Stahlhelm in der Konferenz.”
Ein sehr erschreckendes und mittlerweile auch ganz gut erforschtes Beispiel ist der Effekt von abwertender Rhetorik im öffentlichen Diskurs auf die ganz praktisch verübten Verbrechen an Minderheiten. Kurz: Politische Hetze durch Politiker:innen und Medien steigert die Hasskriminalität. Wer denkt jetzt auch an einen gewissen orangen Mann mit kleinen Händen? Man spricht im populärwissenschaftlichen Raum sogar schon vom Trump-Effekt.
Und ja: auch Du bist wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad anfällig dafür. Eine an dieser Stelle immer gern zitierte Studie ist die, in der Proband:innen ein und derselbe Tee mit verschiedenen Namen präsentiert wird. Hießt er z.B. “Tropical Feelings” schmeckten die Tester:innen exotische Früchte, wurde er als “Vor dem Kamin” vorgestellt, schmeckten sie auf einmal Apfel und Zimt aus ein und derselben Teemischung.
Wo bleibt denn jetzt die Verbindung zu Narrativen und positiven Zukunftbildern?
Die kommt jetzt. Ein schöner Ansatz stammt von Alex Danco, der vorschlägt, die Zukunft zu schreiben, wie eine sorgfältig durchdachte Geschichte. Er beginnt damit, dass komplexe Systeme (sei es eine Organisation oder eine Gesellschaft) nicht durch eine einzige Handlung verändert werden können. Vielmehr benötigt die Veränderung von Systemen eine Abfolge stringenter Taten: Von der Idee über das Narrativ zur Handlung. Idealerweise schafft man es, sein individuelles Narrativ zu einer kollektiven Zukunftsvision zu entwickeln. Danco empfiehlt hier das Mittel der Geschichtsschreibung: Man nehme alle Zutaten für eine wirklich gute (Zukunfts-)Welt und flechte daraus eine nachvollziehbare und anschauliche Geschichte.
Auch wieder sehr abstrakt, daher versuche ich mich an dieser Stelle an einem finalen Beispiel: Thema Mobilität der Zukunft. Nicht erst seit gestern wird diskutiert, wie die Mobilität von morgen am besten aussehen könnte. Wobei – eigentlich war das von Beginn an recht klar, oder? Der Ersatz des unpopulär gewordenen Verbrennungsmotors durch einen elektrischen Antrieb soll die Basis der Fortbewegung der nächsten Generationen sein. Zugegeben: etwas lahm für die vollmundige Ankündigung als Mobilität der Zukunft.
Lahm, aber wenig überraschend. Das Narrativ der individuellen Freiheit auf dem Rücken des metallischen Pferdes (=Auto) ist seit Generationen in unserer Kultur verankert: Es gibt Songs und Filme über Autos, Sportarten, die Autos involvieren, um Autos herum gebaute Städte und Autostädte. Wir fahren ins Autokino, bekommen (je nach Region und Geldbeutel, zugegeben) zur Volljährigkeit fast selbstverständlich einen Führerschein und ein Auto, putzen, pflegen und tunen das blecherne Gefährt. Natürlich ist es einfacher, eine kleine Stellschraube zu verändern und den Rest so zu lassen, wie er ist.
Das Hinterfragen dieses Narrativs könnte im Gegensatz dazu führen, dass wir Mobilität einmal gänzlich neu denken. Hier ein Versuch mit den Leitfragen von Alex Danco:
Der Zweck: Unsere Geschichte braucht einen Zweck, der die Handlungen der darin befindlichen Personen motiviert.
Der Zweck in der mobilen Welt von morgen könnte sein, unabhängig von regionalen und sozialen Gegebenheiten flexibel und umweltschonend von A nach B zu gelangen.
Die Geographie: Wie ist das Umfeld geschaffen, in dem die Menschen handeln?
Das Umfeld ist divers: Metropolen und ländliche Räume existieren nebeneinander und stellen die dort lebenden Personen vor unterschiedliche Herausforderungen. Im nächsten Schritt könnten wir uns fragen, wie genau diese Herausforderungen aussehen und was sie für die Personen bedeuten: Gibt es kulturelle Unterschiede, wie kommunizieren die Regionen miteinander? In einer positiven Zukunft würden regionale Unterschiede z.B. kaum Einfluss auf die Lebenswirklichkeiten der Menschen nehmen.
Die Währung: Was ist die zentrale Handelseinheit?
Natürlich gibt es auch in einer mobilen Zukunftswelt Geld. Geld ermöglicht Zugang zu Mobilität – aber mit Blick auf die Mobilität ist Zeit vielleicht ebenfalls ein wichtiger Faktor. Wer schnell an sein Ziel kommt, hat Vorteile gegenüber anderen.
Danco listet noch weitere Punkte auf (Zeithorizont, Handel, etc.), aber ich glaube die Idee, wie Narrative gestrickt werden können, ist ausreichend illustriert. Mir gefällt an Dancos Ansatz, dass er Leitfragen auf eine Weise formuliert, die von Altbekanntem weglocken: Wir bauen uns eine Welt, eine Geschichte, anstatt dass wir ein ganz klar umrissenes Ziel verfolgen. Das kann helfen, mentale Schranken abzubauen und Diskurse einmal wirklich neu und unvoreingenommen zu denken.
Ich bin mir sicher, der:die ein oder andere fragt sich jetzt: OK, was kann ich vom Sofa aus machen? Einiges. Jede:r von uns kann regelmäßig hinterfragen, welche Ideen und Narrative sich hinter unseren eigenen Einstellungen und Handlungen verbergen. Sich diese bewusst zu machen hilft, deren Probleme zu entlarven. Warum zum Beispiel definieren wir Erfolg in unserer westlichen Welt so stark über Geld? Wir huldigen menschlich fragwürdigen Personen wie Elon Musk und Jeff Bezos, wobei objektiv klar sein sollte, dass diese weder alleine für ihren wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich sind, noch damit irgendwem etwas Gutes tun. Wie kommt dann jemand auf die Idee, wir bräuchten mehr davon?

Könnten wir nicht damit anfangen, unsere Erde zu einem gerechteren, lebenswerteren Ort zu machen, indem wir zum Beispiel andere Vorbilder und Statussymbole propagieren: Die hilfsbereite Nachbarin, den engagierten Lehrer oder den zufriedenen älteren Herren mit seinen zehn Katzen, der den Nachbarskindern Bonbons zusteckt?
Wer braucht Porsche und Rolex? Ich möchte Freunde, die im Notfall auch nachts um drei für mich da sind. Ich möchte Zeit haben, mich neben der Erwerbsarbeit mit Dingen beschäftigen zu können, die mir am Herzen liegen. Ich möchte Menschen von überall aus der Welt treffen und mir ihre Geschichten anhören dürfen. Ich möchte mir keine Sorgen machen müssen, woher ich eine warme Wohnung und Essen bekomme. All das (und noch viel mehr) macht für mich eine lebenswerte Zukunft aus.
Wir können alle die Zukunft mitschreiben – ein Narrativ nach dem anderen.
Related Posts
1. Juni 2023
Von Mainstream, Nischen und Neugier
Wann habt Ihr zuletzt eine Doku über Syphilis geschaut? Ich erst vergangene…
1. Juni 2023
Die Freude des Abschaltens
Das Internet nimmt sehr rapide einen immer größeren Stellenwert im Leben der…
1. Juni 2023
Die Entzauberung des Management-Sprechs
Habt ihr heute schon im New Normal Synergien gebildet oder jemanden im Loop…