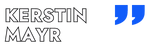Die Beziehung zwischen Mensch und Pferd ist fast so alt wie die Zivilisationsgeschichte. Man weiß, dass assyrische Könige bereits um 1500 v.Chr. aufwändige Stallungen und Trainer für ihre Pferde unterhielten, die mit Streitwagen in den Krieg ziehen sollten. Homers Bericht über das Wagenrennen in der Ilias folgte nur unwesentlich später. Zugegeben: Die Trabrennbahn in Berlin Mariendorf hat sicherlich wenig mit dem antiken Königreich Assyrien gemein. Eine faszinierende Parallelwelt eröffnet sich dennoch jedem und jeder, der oder die bereit ist, die drei Euro Eintrittspreis dafür auf den Tisch zu legen.
Es ist ein schwül warmer Sonntagnachmittag Ende Juni, irgendwo in einem beschaulichen Berliner Randbezirk. Vom Stadtzentrum aus fährt man zur traditionsreichen Trabrennbahn Mariendorf – gefühlt – sehr weit nach Süden raus, immer geradeaus. Irgendwann rechts, vorbei an einer – gefühlt – sehr großen, sehr beigen Seniorenwohnanlage im Charme der 1990er Jahre. Wenn man es nicht besser wüsste – man könnte auch in Mönchengladbach sein.
Heute findet hier unter anderem das legendäre Adbell-Toddington-Rennen statt. Aus dem Programmheft erfahre ich, dass es nach einem berühmten Hengst benannt und vor 101 Jahren zum ersten Mal ausgetragen wurde. Mehr Substanzielles entnehme ich dem improvisierten Magazin im Stil einer zwanzig Jahre alten Schülerzeitschrift nicht. Es besteht für meinen unwissenden Blick nur aus Tabellen, Zahlen und Namen. “Russel November”, “Juan Les Pins”, “Västerbo Naughty”. Bei einigen ist nicht gleich ersichtlich, ob Pferd, Besitzer:in oder Trainer:in gemeint ist.
Die Mariendorfer Bahn wurde im Jahr 1913 eröffnet. Wer jetzt an Szenen aus Peaky Blinders denkt, wird spätestens beim Betreten des Geländes enttäuscht. Hauptgebäude und Tribünen sind klassische, brutalistische Konstrukte mit klaren, geometrischen Linien, vielen Fluchten und dem Charme einer alten Turnhalle. Architekturfans könnten hier jedoch sicher die ein oder andere nette Stunde verbringen. Gute Motive gibt es allemal – und ausreichend Platz, die Besucherzahl hält sich in Grenzen. So viel Raum für so wenig Mensch ist man als (Wahl-)Berlinerin gar nicht mehr gewohnt. Irgendwie befreiend.
Der Parkplatz ist eine Wiese hinter einer angrenzenden Gebäudereihe. Es wird nicht auf den ersten Blick klar, welche der Gebäude noch in Betrieb oder bereits Ausflugsziele für Lost-Places-Suchende sind. Man kann auch nicht erkennen, ob alle davon tatsächlich zur Trabrennbahn gehören. Entsprechend bin ich wirklich überrascht, als mein Begleiter und ich über einen Trampelpfad zwischen einem – tja – gepflasterten Platz ohne ersichtlichen Zweck und einem brutalistischen Monsterbau fast unmittelbar vor dem Racetrack herauspurzeln. Naja, nicht ganz. Dazwischen ist noch eine Hecke. Und vor dieser Hecke reihen sich diverse Trabrennenthusiast:innen auf – überwiegend Senior:innen und Familien ohne klare Zugehörigkeiten dafür mit bunt gemusterter Oberbekleidung.
Zwischen Mythos und Verfall: Der Mikrokosmos Trabrennbahn
Ich schaue mich um. Ich war vor Jahren schon mal auf einer Trabrennbahn, habe jedoch mein bei dieser Gelegenheit gesammeltes, oberflächliches Wissen darüber schon wieder verloren. Unauffällig scanne ich mein Umfeld, um Verhaltensmuster zu erkennen und nachzuahmen. Ich möchte mich nicht als Neuling outen – oder noch schlimmer – als Eindringling wahrgenommen werden. Tatsächlich ist es nicht ganz einfach, dem Rennbahngelände oder seinen Besucher:innen eine Logik zu entlocken. Lose zueinander gehörige Grüppchen verteilen sich über das Außengelände, sitzen auf wahllos angeordneten Bänken, Festzeltgarnituren und weißen Plastikgartenstühlen. Es wirkt wie ein kleines Ökosystem, in dem sich jede Art ihre Nische sucht: Der Canasta-Club aus dem Seniorenheim Rosenhof besiedelt die linke Ecke der Terrasse vor dem Haupthaus, der Kegelverein Marienfelde-West nimmt die mittlere der Haupttribüne ein, Familie Müller-Schulze nutzt eine albern nah an der Hecke platzierte Bank als Picknicktisch.
Zum ersten Mal nehme ich die Ansagen des Renntagsmoderators wahr und bin beeindruckt, wie unironisch er die teils sehr abstrusen Pferdenamen wieder und wieder aufsagt. “… Sloppy Joe Jr. läuft heute in Bestform auf … Lola Dragon ist heute als Underdog dabei, war aber im Jahresdebüt nur an einem Gegner gescheitert …” Im Kontrast zur vernachlässigten Erscheinung der Anlage wirkt die PR drum herum extrem professionell. Über ein verzweigtes System von Stadionlautsprechern wird der Rennkommentar über das weitläufige Gelände getragen, über alle ökologischen Nischen hinweg. Es kommt zu mehreren Fehlstarts, weshalb sich das aktuelle Rennen verzögert. Den genauen Grund verstehe ich nur akustisch. Insgesamt geht es lautstärketechnisch relativ gediegen zu. Gut, Trabrenn-Hooligans habe ich nicht ernsthaft erwartet, aber doch ein bisschen mehr Ausgelassenheit. Viele Leute sind in ihre Programmhefte vertieft und es ist nicht erkennbar, ob aus Interesse oder Apathie. Bei mir stellt sich dennoch (oder vielleicht deswegen) eine merkwürdige Entspanntheit ein. Tempo gibt es heute nur auf dem Geläuf, Stress höchstens bei den Fahrer:innen und Pferdebesitzer:innen, aber nicht bei mir.
Ich schließe mich dem Strom an, der ins Hauptgebäude mäandert. Eine lange Reihe unbesetzter Wettkassen lässt vergangenen Glanz erahnen. In sämtlichen Ecken hängen Röhrenfernseher, die das Renngeschehen in die spärlich illuminierten Innenräume übertragen. Ich bin ein zweites Mal erstaunt über die Professionalität der Berichterstattung. Insbesondere in Anbetracht der spärlichen Besucherzahlen. Rentner:innen stehen oder sitzen verloren an Tischen, blicken durch ihre Programmhefte hindurch oder fokussieren ihre Wettscheine mit einer mechanisch wirkenden Konzentration. Ob sie – im Gegensatz zu mir – mit den ganzen Zahlen und Namen etwas anfangen können?
“Die Rennbahn hier ist doch nicht schön! Hier wird nichts mehr gepflegt. Hoppegarten ist sicher noch sehenswert, aber nicht das hier”, belehrt mich Maggi, als er mich mit meiner Kamera entdeckt. Mit vollem Namen heißt er Karl Maiwald [*Name geändert]. Und kommt öfter her. Wir unterhalten uns an einem Stehtisch mit rotem PVC-Überwurf, unmittelbar vor einem kleinen Schanktresen, dem “Traber Treff”. Maggi wird im nächsten Jahr achtzig, war lange Oberstudienrat und im Fußball aktiv. “Ich bin ja froh, dass ich so alt geworden bin! Ihr jungen Leute habt es nicht leicht, geht arbeiten und könnt euch nicht mal was davon kaufen.” Nach meinem Beruf hat er mich allerdings nicht gefragt. Und auch sonst scheint er an einem Dialog wenig interessiert zu sein. Als ich mich umschaue, beschleicht mich der Verdacht, dass die umstehenden Herren mit ihren Programmheften Maggis Geschichten schon alle kennen. Vollgemalte Wettscheine und leere Blicke versammeln sich um die Stehtische. Außer Maggi redet niemand.
Wo man noch alles sagen darf
Ein paar Fragen habe ich dann aber doch. Kann er mir einen Tipp geben, auf welches Pferd ich setzen sollte? “Hm ja, … die Trainer muss man kennen. Eigentlich sind alle gut.” Kommt er öfter her? “Ja, früher noch mehr als heutzutage.” Schnell ist das Thema aber wieder Tagespolitik. Und leider vertraute Narrative. Die Ausländer nehmen uns die Jobs weg! Wie damals, nach dem Krieg! Ich persönlich kenne nicht viele Oberstudienräte mit Migrationshintergrund. Aber ich kenne insgesamt wenige Oberstudienrätin:innen. “Wenn ich an diesen Spielhallen vorbeifahre, dann kommen da nur Ausländer raus”, echauffiert sich Maggi weiter und mutmaßt, dass dort unsere Steuergelder verspielt werden. “So schlecht kann es denen ja nicht gehen, wenn sie in die Automatencasinos gehen!” An uns läuft eine eher mitteleuropäisch und wenig wohlhabend aussehende Kleingruppe vorbei zum Wettschalter.
Maggi bietet an, auf mein Wasser aufzupassen und ich nutze die Gelegenheit, mich draußen weiter umzusehen. Ich freue mich einerseits, mit meiner neuen Bekanntschaft etwas tiefer in den für mich neuen Mikrokosmos Trabrennbahn eingetaucht zu sein – andererseits hat es mich aber auch aus meiner bräsigen Entspanntheit gerissen, die sich mit dem Betreten des Platzes breitgemacht hatte. Absolut nichts macht hier auf mich den Eindruck, dass es versucht, hip, woke, alternativ, exklusiv oder überhaupt irgendwas zu sein. Unprätentiös. Die Gebäude auf dem Gelände sind in die Jahre gekommen. Alles wirkt ein bisschen wie eine Studentenwohnung, in die jede:r Bewohner:in etwas mitgebracht hat, was er oder sie irgendwo aufgeklaubt oder bei den Eltern stibitzt hat. Neben dem monströsen Turnhallen-Haupthaus steht etwas abseits die einzige als solche kenntliche Außentribüne, daneben ein neobarock anmutendes Teehaus. Nicht der gewohnte Neuköllner Sperrmüll-Möbel-Appeal, sondern die 1960er-Kurklinik.
Dazu passt die Gastronomie. Die ist überraschend teuer und – weniger überraschend – echt schlecht. Ich hätte nicht vermutet, dass man bei Currywurst/Pommes viel falsch machen kann. Und trotzdem gönnen wir uns anderthalb Portionen der lauwarmen Pampe und waten damit durch die schwüle Sonntagnachmittagsluft zur Tribühne. Dabei umschiffen wir elegant diverse suchend-dreinblickende Menschen, die uns – zwar sehr langsam, dafür unkoordiniert – entgegentaumeln. Ihre farbenfrohen Shirts und Blusen erleichtern die Ausweichmanöver. Die empfundene weicht signifikant von der tatsächlichen Entfernung ab, die Curry-Pommes wird währenddessen von der Luftfeuchte warmgehalten. Trotz aller Widrigkeiten erreichen wir unser Ziel und nehmen in zweiter Reihe Platz. Insgesamt gibt es sechs Reihen, die aus hölzernen Umrandungen kleiner Parzellen bestehen. Viele davon haben an den Seiten überstehende Holzbretter als Tischchen, Stühle muss man selbst mitbringen. Das haben wir zu spät gesehen und wählen daher einen von Vorgänger:innen bestuhlten Platz. Außer uns sind noch drei weitere Pärchen auf der Tribüne. Das wundert mich, da man von hier einen wirklich guten Blick auf die Bahn hat. Dort laufen – beziehungsweise fahren – sich gerade ein paar Gespanne warm. Uns ist bereits warm und mit vollem Bauch gleiten wir in einen Dämmerzustand, den andere Gäste bereits erreicht haben.
Ich schrecke auf, als plötzlich jemand spricht. “Uns Deutschen geht es so gut, wir müssen viel mehr spenden!” Es ist nicht der Kommentator. Als ich mich umschaue, blicke ich in ein runzliges Gesicht, mehr Bart als Zähne, krauses, graues Haar lugt unter einer Schiebermütze hervor. Spricht der Mann mit uns?
“Ja, wem es gut geht, der muss auch teilen!”, spricht der Krausbart weiter. Wir nicken stumm. Wie hat er sich wohl an uns herangeschlichen? Jetzt jedenfalls lehnt er sich unbeholfen über das Geländer seiner Sitzparzelle und spricht weiter zu uns als seinem ausgewählten Publikum. “Wissen Sie, wir haben uns den Wohlstand hart erarbeitet – oder glauben Sie nicht?”
“Ich persönlich glaube, wir hatten einfach Glück”, entgegnet meine Begleitung. Stille.
“Ja, da haben Sie sicher Recht.” Unser Sitznachbar stöhnt auf und wendet sich von uns ab, richtet seinen Blick wieder auf die Rennbahn.
Gewinne! Gewinne! Gewinne!
Stimmt, es gibt ja auch noch die Trabrennen. Bisher habe ich diese nur als Abfolge von Lautsprecherdurchsagen wahrgenommen. Die Stadionsprecher, zwei Männer mittleren Alters in weißen Hemden, kommentieren das Geschehen auf der Bahn mit demselben Tempo und Verve wie eine Fußballmeisterschaft. Ich verstehe auch nach gewissenhaftem Studium des Programmheftes inhaltlich wenig. Das hält mich und meine Begleitung jedoch nicht davon ab, auch eine Wette zu platzieren. Deshalb sind wir ja irgendwie hier. Maggi hatte uns geraten, beim sogenannten Königsrennen zu setzen. In unserem Fall das eingangs erwähnte Adbell-Toddington-Rennen. Wenn ich das Programmheft richtig deute, sind 20.000 Preisgeld zu gewinnen. Ob das für diejenigen gilt, die auf der Rennbahn oder am Wettschalter antreten, erschließt sich mir nicht. Ich bin immernoch keine Eingeweihte. Egal. Nach acht Euro für zwei Wasser und 15 Euro für Currywurst und zwei Pommes können fünf Euro, aus denen potenziell mehr werden kann, nicht schlecht angelegt sein.
Als Favoriten für den Sieg gelten Gio Cash, Y Not Diamant und Schampus. Alle tragen den finanziellen Erfolg wenigstens im Namen. Wenn man keine Ahnung hat, muss man auf sein Bauchgefühl setzen und mein Bauchgefühl findet eine Zwillingswette auf Gio Cash und Schampus linguistisch nur folgerichtig. Wir füllen einen Wettschein aus und finden einen Platz unmittelbar hinter dem Kommentatorenhäuschen auf weißen Plastikstühlen. Dort können wir nun verfolgen, wie sich unser Geld vermehren wird. Die Pferde werden bereits mit ihren Fahrer:innen nacheinander angekündigt und flanieren entlang der Zuschauerseite. Ich habe von Pferden an sich ebensoviel Ahnung wie vom Trabrennsport und finde alle athletisch und schön.
Es geht los. Die Wettkämpfer (tatsächlich alles Hengste und Wallache) versammeln sich hinter dem Fahrzeug mit ausgebreiteten Gitterflügeln, die ab einem bestimmten Tempo eingefahren werden und den Pferden freie Bahn gewähren. Plötzlich geht alles sehr schnell. Der Kommentator sieht mehr als ich und verkündet, dass Gio Cash und Schampus die Führung übernommen haben. Sauber! Den Blicken der Menge entnehme ich, dass sich das Feld zügig auf unsere Seite zubewegt. Gio Cash und Schampus weiterhin in Führung. Zack, vorbei! Aber Y Not Diamant und Django Hill finden, dass es zu früh ist, den Sieg abzuschreiben und greifen an. Ich sehe eine braune, sich schnell bewegende Masse am anderen Ende der Bahn. Und tatsächlich: Auf den letzten Metern zieht Django Hill an seinen Kontrahenten Y Not Diamant und Schampus vorbei. Ein überraschender zweiter Platz.
Die Überraschung holt uns unsanft aus unserer Bräsigkeit zurück ins Hier und Jetzt. Das Auftauchen ist etwas ernüchternd.
Ein Blick auf die Uhr verrät, dass wir bereits seit über drei Stunden hier sind. Ich bin erstaunt. Die Zeit verging schnell, wenn man bedenkt, wie wenig eigentlich passiert ist. Es ist fast, als hätte das Tempo der überwiegend seniorigen Besucher:innen auf uns abgefärbt. Über das Gelände wandern, einen Platz zum Sitzen suchen, sitzen, gucken, aufstehen, über das Gelände wandern, einen anderen Platz zum Sitzen suchen, … Ich fühle mich tatsächlich so entspannt wie lange nicht. Und das ganz ohne Achtsamkeits-App. Schön.
Zurück in die ... echte Welt?
Wir stromern noch ein letztes Mal zwischen den Festzeltgarnituren, improvisierten Sitzgruppen aus Draußen- und Drinnenmobilar, Rentner:innen und Familien umher, um vielleicht ein bisschen Entspannung mit nachhause zu nehmen. Dabei fällt mir auf: Obwohl hier viele Menschen in Gruppen stehen, gibt es doch wenige Gespräche. Auch in der Gruppe älterer Herren, die sich um Maggi versammelt hat, scheint geistig lieber jeder für sich zu bleiben, obwohl sie sich offenbar gut kennen. Nach einer Abschlussrunde vorbei an der langen Reihe unbesetzter Wettkassen verlassen wir die Rennbahn. Und ich frage mich, ob die Mehrheit der Besucher:innen wohl herkommt, nicht, um wie wir ein wenig vor der Welt da draußen zu fliehen, sondern um wenigstens noch ein bisschen an ihr teilzuhaben.
Related Posts
1. Juni 2023
Von Mainstream, Nischen und Neugier
Wann habt Ihr zuletzt eine Doku über Syphilis geschaut? Ich erst vergangene…
1. Juni 2023
Die Freude des Abschaltens
Das Internet nimmt sehr rapide einen immer größeren Stellenwert im Leben der…
1. Juni 2023
Die Entzauberung des Management-Sprechs
Habt ihr heute schon im New Normal Synergien gebildet oder jemanden im Loop…