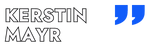Ich habe mir vor geraumer Zeit einen digitalen Frühjahrsputz verordnet. Und der wurde auch bitter nötig. An die 22.000 Fotos hatten sich auf meinem Handy angesammelt. Wenn ich Freunden ein bestimmtes davon zeigen wollte, mussten die erstmal fünf bis zehn Minuten mit meinem Haaransatz sprechen – so lange dauerte es, das gesuchte Objekt der Begierde aus den Untiefen meiner Speicherkarte zu bergen.

Speicher ist hier das entscheidende Stichwort. Mein erstes Smartphone habe ich 2010 gekauft. Das Ding hatte immerhin ganze 512 Megabyte internen Speicher – damit musste ich sorgsam haushalten. Nicht jedes Foto war es auch wert, auf meinem Handy zu verweilen. Da ich noch das analoge Fotografieren mit Filmen kannte, wusste ich, dass man sich das Abdrücken des Auslösers bei jedem Motiv gründlich überlegen musste. Einen Film für 24 Mark entwickeln lassen und dann hat man nur die Füße der Leute drauf? Das geht nicht.
Unbegrenzter Speicher macht uns zu Daten-Messies
In der digitalen Welt hingegen gelten andere Gesetze. Mit jedem meiner Handys wuchs der Speicher. Reichte dieser nicht, wurde mit einer externen Speicherkarte nachgeholfen. Meist wurde der Kauf eines neuen Gerätes fällig, wenn ich den internen Speicher des alten derart zugerümpelt hatte, dass es nur noch eingeschränkt funktionierte. Gut. Ich hätte diesen Moment zum Anlass nehmen können, alle meine digitalen Besitztümer einmal gründlich auszumisten. Aber warum? Ich konnte mein unsortiertes Chaos doch problemlos zum neuen Galaxy SXX mitnehmen – und hatte dann noch mindestens zwei Drittel Platz zum Befüllen.
Dass wir unser Leben dokumentieren, ist nicht neu. Die Masse an Informationen, die wir sammeln können, ist es jedoch.
Der Autor Drew Austin schreibt in diesem fantastischen Text über eben jenes Phänomen: “Indem Google den Eindruck erweckt, dass unsere persönlichen Datenspeicher unerschöpflich seien, macht es uns alle zu Datensammlern.” (frei übersetzt aus dem Englischen). Austin setzt an im Jahr 2004, mit der Einführung von Gmail als Google-Service. Schon damals hatten die Nutzer:innen mit einem Gigabyte hundertmal mehr Speicher zur Verfügung als bei den Konkurrenten Yahoo und Hotmail. Bis 2013 ist dieser freie Speicher nochmal auf 15 GB angewachsen. Das Problem, alte Mails löschen zu müssen, um neue zu empfangen (ja, so war das tatsächlich mal, auch mit SMS), wurde aus der digitalen Welt geschafft.
Ordnest du noch oder suchst du schon?
Ähnlich wie meine Fotosammlung (zwei Drittel verwackelte, zu dunkle oder zu helle Fotos, ein Drittel gute, viele Screenshots von Dingen, die ich mir gerne merken würde, viele Messenger-Fotos von Freund:innen, die möchten, dass ich mir etwas merke …) sieht also auch mein Mail-Postfach aus. Und nicht nur meins. Die umfassende Suchfunktion von Google macht das Sortieren (und das AUSsortieren) überflüssig. Mit den richtigen Stichworten finde ich Nachrichten meiner Hausverwaltung, Bestellbestätigungen oder Geburtstagsgrüße. Die Zeit, die ich damit verbringen würde, diese zu ordnen, wäre unnötig verbracht. Das Chaos kostet mich nichts, nicht mal Zeit (anders, als bei meiner Fotosuche …).
Insbesondere dank Google ist die Suche an die Stelle des Sortierens von persönlichen Informationen getreten. Anstatt unsere Daten nach einem lesbaren System zu ordnen oder zu wissen, wo sich die Dinge befinden, können wir alles auf einen scheinbar unübersichtlichen Haufen werfen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass nachfolgende Generationen, die mit dem Prinzip Suchen-statt-Ordnen aufgewachsen sind, das Konzept von Dateiordnern und Verzeichnissen für überflüssig halten und daher nicht nutzen (können).

Weniger-ist-mehr fällt dem Mensch oft schwer
Und tatsächlich appelliert die schier endlose Verfügbarkeit von Speicherplatz an einen sehr menschlichen Instinkt: FOMO (Fear of Missing out), die Angst, etwas zu verpassen. Diese ist so alt, wie die Menschheit selbst. Wer überleben möchte, schafft dies einfacher mit den relevanten Informationen: Wo bekomme ich Nahrung und sauberes Wasser? In unserer heutigen westlichen Gesellschaft vielleicht eher: Welchen Trend darf ich nicht verpassen? Auf welcher Party muss ich mich zeigen?
Mit dem Wissen der Welt in der Hosentasche wird es zunehmend schwieriger für sich selbst zu definieren, was eigentlich relevant bedeutet. Und noch eine Tendenz spielt der digitalen Sammelwut in die Hände: Eine Studie amerikanischer Forscher:innen hat nachgewiesen, dass es uns beim Lösen von Problemen leichter fällt, Dinge hinzuzufügen als welche wegzulassen oder gar zu entfernen. Als mögliche Ursache nannten viele Proband:innen die Sorge vor negativem Feedback – wer wegnimmt oder auslässt, ist faul oder kann den Beitrag anderer nicht wertschätzen. Die Mehr-ist-Mehr-Mentalität hat also auch eine gesellschaftliche Komponente.
Das Online-Hirn
Seit geraumer Zeit bin ich auf der Suche einer Anwendung, die mir hilft, den Überblick über meine gesammelten, digitalen Schätze zu bewahren. Dort finden sich neben Mails und Fotos endlose Merklisten und gespeicherte Artikel mit Dingen, die ja irgendwann nochmal wichtig sein könnten oder eine für mich in dem Moment interessant klingende Überschrift hatten. Das Sammeln ist an dieser Stelle ein Versuch, die Informationsflut, mit der ich jeden Tag konfrontiert werde, in eine Art externen Speicher zu verlagern. In der Theorie ist das spannend und nützlich. Ich muss mir nicht alles sofort anschauen oder lesen – ich kann es dann tun, wenn ich die Zeit dafür finde.
Aber tue ich das wirklich? In der Praxis habe ich nicht das Gefühl, schlauer, produktiver oder besser informiert zu sein als vor dem Zeitalter der endlosen Cloud-Speicher und großzügigen Datenraten. Gelegentlich ertappe ich mich dabei, dass ich kaum innehalte, um über etwas Wichtiges, das ich gelesen habe, nachzudenken. Stattdessen wird es abgeheftet, um später bedacht zu werden. Oder auch nicht. Ein Effekt meines externen Gedächtnisses ist, dass es mich dazu bringt, schneller und in größeren Mengen zu konsumieren.
Auch hier bin ich nicht alleine: In einer 2019 in der Zeitschrift World Psychiatry veröffentlichten Studie mit dem Titel „The ‚online brain‘: How the Internet may be changing our cognition“ (“Das ‚Online-Gehirn‘: Wie das Internet unsere Wahrnehmung verändern kann”) vermuten die Forscher, dass „das Internet zu einem ’supernormalen Stimulus‘ für das transaktive Gedächtnis wird, so dass alle anderen Möglichkeiten der kognitiven Entlastung (einschließlich Bücher, Freunde und Gemeinschaft) überflüssig werden, da sie durch die neuartigen Möglichkeiten der externen Informationsspeicherung und -abfrage, die das Internet ermöglicht, verdrängt werden.“ (frei übersetzt aus dem Englischen).
Das klingt erstmal nicht so toll. Das Papier legt nahe, dass „die Abhängigkeit von der Online-Suche den Gedächtnisabruf behindern kann, indem sie die funktionelle Konnektivität und Synchronisation der damit verbundenen Gehirnregionen verringert“ (frei Übersetzt aus dem Englischen). Die Forschenden weisen aber auch darauf hin, dass dieser Prozess auch kognitiven Raum in anderen Teilen unseres Gehirns freisetzen könnte. Es wird vermutet, dass die Grenze zwischen dem, was wir wirklich wissen, und dem, was das Internet weiß, weiter verwischt. Kenne ich: Ich überfliege die aktuellen Überschriften auf Spiegel Online und denke, ich habe mich zu den Themen informiert …
Kuratieren als Lösung?
Ein Trend, der kein so neuer mehr ist, ist das Kuratieren von Inhalten als Gegenentwurf zum Überangebot der modernen Welt. Wer selbst unentschlossen ist, kann andere für sich wählen lassen. Der Begriff nimmt Bezug auf den:die Kurator:in (vom lateinischen curare = sorgen, sich kümmern) eines Museums, der die Exponate einer Ausstellung nicht nur auswählt, sondern auch über ihre Anordnung und Präsentation entscheidet. Ein:e Kuratorin ist idealerweise Expert:in auf seinem:ihrem Gebiet, gut vernetzt und trendaffin. Wie ein Trüffelschwein wühlt er oder sie sich durch die Untiefen eines bestimmten Bereiches (Filme, journalistische Artikel, Bücher, etc.), wählt die relevantesten aus und kommentiert sie im besten Fall. Wir Kibibitse tun das auch – alle vierzehn Tage in unseren Bites am Ende des Newsletters.
Andere Beispiele gibt es zahlreiche, wie die Seite Piqd. Redakteur:innen empfehlen auf unterschiedlichen, nach Themen sortierten Kanälen, zwischen fünf und zehn Texten. Bevorzugt Analysen und Essays statt reiner Nachrichtenberichte. Statt also selbst zu sammeln, abzuspeichern und das Gesammelte zu vergessen, kann hier von anderen sammeln lassen und nur das lesen, was wirklich von Interesse ist. Auch für Filme gibt es eine Plattform, die auf Klasse statt Masse setzt: MUBI. Ein Gegenentwurf zum Überfluss von Netflix, bietet MUBI jeden Tag einen Film – von Indie-Kino bis Klassiker. Jeder Film ist dreißig Tage verfügbar, sodass man jeden Tag zwischen dreißig Filmen wählen kann.
Kuratierte Services können eine gute Möglichkeit sein, Zeit zu sparen, sich auf Relevantes zu konzentrieren und – durch Empfehlungen – neugierig für Neues zu bleiben. Wir sollten dabei eines jedoch nicht vergessen: Wer auswählen lässt, gibt auch ein Stück Selbstbestimmtheit aus der Hand. Und verlernt schlimmstenfalls noch mehr, für sich selbst Relevantes auszuwählen.
Was bleibt (von uns)?
Nicht nur mein Foto-Chaos hat mich vor einigen Jahren dazu bewogen, alles, was mir wirklich wichtig ist, auch analog abzulegen. Urlaubsbilder wandern kuratiert in Fotobücher, wichtige Dokumente in Ordner. Unsere Unfähigkeit, uns zu entscheiden, zu priorisieren und zu ordnen, kann sich nämlich auch rächen. Auf unterschiedliche Weise.
Wer ständig sammelt, kommt weniger zum Lesen der (individuell) relevanten Texte. Wer – wie ich bis vor Kurzem – ständig durch unsortierte Ordner scrollt, verliert wertvolle Zeit, die Erinnerungen auch wirklich wertzuschätzen oder zu teilen. Wie können wir überhaupt noch etwas wertschätzen, wenn es nur eine Datei in einem Wust von Chaos ist? Vermutlich vermissen wir sie erst, wenn wir sie suchen.
Im Jahr 2013 kam ich von einem Praktikum aus den USA zurück. Ein für mich sehr schönes und prägendes Erlebnis. Die Fotos, die ich mit meinem Handy gemacht hatte, waren mir darauf zu unsicher. Außerdem war der Speicher mal wieder ausgereizt. Also verschob ich alle Bilder auf mein Laptop, welches sich kurz darauf aber in die ewigen Jagdgründe verabschiedete. Die Festplatte war unlesbar und mit ihr wurden aus meinen wertvollen Erinnerungen unbrauchbarer Datenmüll.
Hat dies nun dazu geführt, dass mir diese Erinnerungen wertvoller erscheinen, weil sie nicht mehr optisch greifbar sind? Oder sind sie gerade deswegen weniger präsent in meinem Leben?

Dieser Post ist im Original als Beitrag des kibibetters im April 2022 erschienen.
Related Posts
1. Juni 2023
Von Mainstream, Nischen und Neugier
Wann habt Ihr zuletzt eine Doku über Syphilis geschaut? Ich erst vergangene…
1. Juni 2023
Die Freude des Abschaltens
Das Internet nimmt sehr rapide einen immer größeren Stellenwert im Leben der…
1. Juni 2023
Neues wagen vs. neuer Wagen
“Innovativ” ist mit hoher Wahrscheinlichkeit neben anderen Begrifflichkeiten…